
Aphthitalit neben Tellur, Johillerit und Calciojohillerit auf vulkanischer Schlacke
Arsenatnaya Fumarole, zweiter Schlackenkegel, nördlicher Bruch, Große Spalteneruption,
Tolbachik-Vulkan, Kamtschatka, Russland
Stufe: 2,2 x 2,2 cm
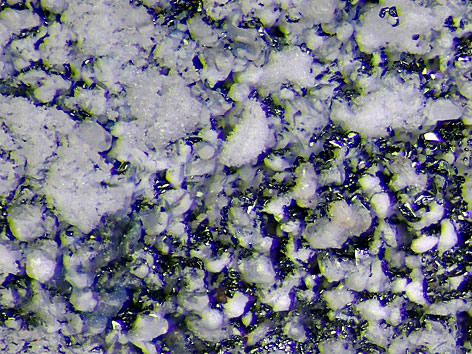
Aphthitalit xx (weiß) neben Tellur xx
Detail der links abgebildeten Stufe
Bildbreite: 3 mm
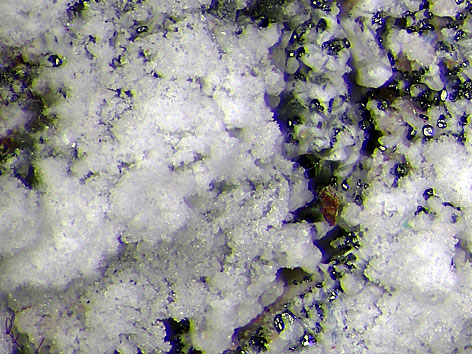
Aphthitalit xx (weiß) neben Tellur xx
Detail der oben links abgebildeten Stufe
Bildbreite: 2,5 mm
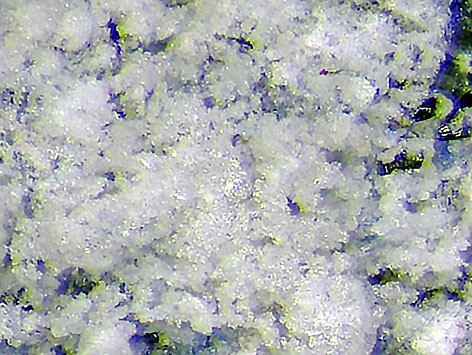
Aphthitalit xx (weiß)
Detail der oben links abgebildeten Stufe
Bildbreite: 1,6 mm